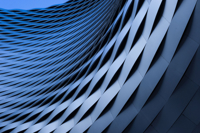Ab dem 30. Dezember dieses Jahres verpflichtet eine neue EU-Vorgabe die Mitgliedstaaten dazu, bei mindestens 30 % ihres Ausschreibungsvolumens für erneuerbare Energien neben dem Preis auch sogenannte nicht-preisliche Kriterien zu berücksichtigen – etwa Nachhaltigkeit, Resilienz, oder verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.
Anlässlich dieses wichtigen Wendepunkts für Regierungen und Regulierungsbehörden veröffentlichen wir unseren Diskussionsbeitrag: Nicht-preisliche Kriterien in Non-price criteria in offshore wind auctions: How to strike the balance (Englisch). Darin zeigen wir, welche Herausforderungen sich bei der Umstellung für das Ausschreibungsdesign ergeben – und welche Folgen dies für Wettbewerb, Komplexität und Kosten haben kann.
Nicht-preisliche Kriterien in Offshore-Wind-Ausschreibungen: Wie man das richtige Gleichgewicht findet
Herunterladen (EN)Warum das wichtig ist
Bisher standen bei Offshore-Wind-Ausschreibungen in Europa Preisgebote im Vordergrund. Das ändert sich mit dem Net-Zero Industry Act (NZIA). Um die Offshore-Windkapazität bis 2030 zu verdreifachen, sollen nicht-preisliche Kriterien helfen, die Resilienz der Lieferketten zu stärken, die Abhängigkeit von Drittstaaten zu verringern und ökologische sowie soziale Standards zu fördern.
Doch dieser Wandel bringt Zielkonflikte mit sich: Nicht-preisliche Kriterien können die Kosten für Projektierer erhöhen, die Teilnahme an Ausschreibungen erschweren und zu geringeren Staatseinnahmen führen. Daten aus deutschen Ausschreibungen 2023 und 2024 zeigen das deutlich: Verfahren mit nicht-preislichen Kriterien erhielten deutlich niedrigere Gebote als rein preisbasierte – mit spürbaren fiskalische Auswirkungen für die öffentliche Hand.
Vier zentrale Fragen für das Auktions-Design
Um den Wandel erfolgreich zu gestalten, braucht es eine sorgfältige Abwägung. Unser Diskussionsbeitrag benennt vier zentrale Aspekte:
- Welche nicht-preislichen Kriterien sollten berücksichtigt werden?
Nur solche, die einen klaren, zusätzlichen Mehrwert bieten – ohne bestehende Instrumente zu duplizieren oder das Verfahren unnötig zu verkomplizieren. - Wie sollen sie definiert und bewertet werden?
Kriterien müssen eindeutig, messbar und durchsetzbar sein – um Interpretationsspielräume und aufwendige Gebotsprozesse zu vermeiden. - Wie werden sie in das Ausschreibungsverfahren integriert?
Ob als Mindestanforderungen, gewichtete Bewertungselemente oder im Zwei-Stufen-Modell: Jede Variante hat Folgen für Einfachheit, Beteiligung und Preiswettbewerb. - Wie lässt sich die Einhaltung sicherstellen?
Ohne glaubwürdige Überwachung und Durchsetzung drohen die Kriterien an Wirkung zu verlieren – und könnten Ergebnisse verzerren, ohne echten Nutzen zu stiften.
Der Blick nach vorn
Gerade für Offshore-Ausschreibungen in Europa kann es sinnvoll sein, nicht-preisliche Kriterien gezielt und dosiert einzusetzen – etwa als Voraussetzung zur Teilnahme – anstatt über zu komplexe Bewertungsverfahren. Das richtige Maß wird aber vom jeweiligen Kontext abhängen.
Angesichts knapper Zeitpläne und Milliardeninvestitionen ist wenig Spielraum für Fehltritte. Ein durchdachtes Ausschreibungsdesign und klare politische Leitplanken sind entscheidend.
Sprechen Sie noch heute mit unserem Team – per E-Mail an matthias.janssen@frontier-economics.com / michael.zaehringer@frontier-economics.com oder telefonisch unter +49 221 3371 3117.